Eigentlich zählen Antibiotika zu den Medikamenten, die für den ONOO–Zyklus wie Treibstoff wirken. Minocyclin, ein Breitband-Antibiotikum aus der Klasse der Tetracycline, bildet eine Ausnahme, da es sich als effektiv in der Behandlung von Multisystemerkrankungen erwiesen hat, die durch oxidative und nitrosative Stressreaktionen, insbesondere durch Peroxynitrit, charakterisiert sind. Klingt doch dufte, oder?
Grundlagen von Peroxynitrit
Wer von euch diesen Blog schon eine Weile verfolgt, weiß vermutlich auf Anhieb etwas mit dem Begriff „ONOO–Zyklus“ anzufangen, auch bekannt unter dem Namen Peroxynitrit-Zyklus. Peroxynitrit, ein reaktives Stickstoff-Spezies-Molekül, das aus der Kombination von Stickstoffmonoxid (NO) und Superoxid (OO-) entsteht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von zellulärem Stress (Nitrostress). Es verursacht oxidative Schäden an Proteinen, Lipiden und DNA, was zelluläre Dysfunktion und letztendlich den Zelltod zur Folge haben kann.
Forschungsarbeiten von Martin L. Pall, Professor für Biochemie an der Washington State University, und Dr. Bodo Kuklinski, Facharzt für Innere Medizin und Umweltmedizin aus Rostock, haben verdeutlicht, dass chronische Erkrankungen oft Teil von Multisystemerkrankungen sind, die durch nitrosativen Stress entstehen und zu erworbenen Mitochondriopathien führen. Diese sind durch eine breite Symptomvielfalt gekennzeichnet. Für eine kausale Therapie ist der Einsatz einer breiten Palette von Antioxidantien, Vitaminen und Pflanzenstoffen erforderlich, wobei insbesondere Megadosen von Vitamin B12 von Bedeutung sind – aber das ist ja nichts Neues. Was jedoch viele Insider nicht wissen: Auch der gezielte Einsatz von Antibiotika hat sich als wirkungsvoll gegen Nitrostress erwiesen.
Antibiotika und Nitrostress
Eigentlich sind Antibiotika, insbesondere solche, die eine starke Immunreaktion auslösen oder die mitochondriale Funktion beeinträchtigen, ein großes Risiko, da sie zur Verstärkung des ONOO–Zyklus beitragen (siehe Tabelle).
In einer Studie von Kalghatgi (2013) wurde jedoch gezeigt, dass bakterizide (bakterientötende) Antibiotika anders auf die Mitochondrien wirken als bakteriostatische (bakterienwachstumhemmende) Antibiotika. Bakteriozide Antibiotika, wie Ciprofloxacin, Ampicillin und Kanamycin, können demnach bei therapeutischen Dosen mitochondriale Dysfunktion und die Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in Säugetierzellen induzieren. Dieser Effekt wurde sowohl in vivo bei Mäusen als auch in vitro bei menschlichen Zellen nachgewiesen. Die Gabe des Antioxidans N-Acetylcystein (NAC) konnte die schädliche Wirkung dieser Antibiotika zwar abmildern, vollständig vermeiden ließ sich der Schaden jedoch nur durch den Einsatz eines bakteriostatischen Wirkstoffs anstelle eines bakteriziden. Auf einen unter ihnen geht Pall in seinem Buch „Explaining Unexplained Illnesses“* ein: Minocyclin
Minocyclin als Antioxidans
Minocyclin, ein Antibiotikum aus der Klasse der Tetracycline, ist in der Lage, die Synthese von Stickstoffmonoxid zu hemmen und so die Bildung von Peroxynitrit zu reduzieren (Chen et al., 2011). Weiterhin fördert es die Aktivierung von antioxidativen Enzymen, die dazu beitragen können, die durch Peroxynitrit verursachten Schäden zu mindern (Kraus et al., 2005). Darüber hinaus hat Minocyclin neuroprotektive Effekte gezeigt, die insbesondere bei neurodegenerativen Prozessen von Bedeutung sind. Zum Beispiel konnten positive Wirkungen nach der Verabreichung von Minocyclin auf verschiedene neurologische Erkrankungen des zentralen Nervensystems gezeigt werden, wie etwa Multiple Sklerose (MS), Morbus Parkinson und Morbus Huntington sowie nach cerebraler Ischämie und Rückenmarksverletzungen (e.g. Yrjänheikki et al., 1998; Yrjänheikki et al., 1999; Blum et al., 2004).
Positiven Effekte von Minocyclin auf entzündliche und degenerative Erkrankungen des zentralen Nervensystems wurden vor allem in Bezug auf MS anhand eines oft verwendeten Tiermodells, die experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE), erforscht. Dabei zeigte sich, dass die Symptome der EAE bei verschiedenen Ratten- und Mäusestämmen durch die Behandlung mit Minocyclin verringert werden können (Popovic et al., 2002).
Forscher der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg entwickelten mit der Zeit neue Varianten dieser Substanz. Diese neuen Derivate, sogenannte A-Ring-aromatisierte Acetylminocycline, basieren auf der Struktur von Minocyclin und sind ebenfalls vielversprechend für die Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen, die durch oxidativen Stress und/oder mitochondriale Schädigungen verursacht werden.
Die richtige Wahl
Dieser kurze Exkurs über die überraschend positive Wirkung von Antibiotika auf durch Nitrostress verursachte Zellschädigungen verdeutlicht, wie entscheidend die sorgfältige Auswahl von Medikamenten, insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen, sein kann. Die Erkenntnis, dass bestimmte Antibiotika nicht nur bakterielle Infektionen bekämpfen, sondern auch antioxidative und neuroprotektive Eigenschaften besitzen, öffnet neue Möglichkeiten für therapeutische Ansätze.
Die Wahl des richtigen Medikaments kann den Unterschied zwischen einer effektiven Behandlung und möglichen Komplikationen ausmachen.
Falls ihr euch unsicher seid oder mehr über die möglichen Vorteile und Risiken von Antibiotika bei bestehenden Gesundheitsproblemen erfahren möchtet, zögert nicht, euren Arzt zu konsultieren.
Blum, D. et al. (2004). Clinical potential of minocycline for neurodegenerative disorders. Neurobiology of disease, 17(3), 359–366. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2004.07.012
Chen, X. et al. (2011). The prospects of minocycline in multiple sclerosis. Journal of neuroimmunology, 235(1-2), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2011.04.006
Kalghatgi, S. et al. (2013). Bactericidal antibiotics induce mitochondrial dysfunction and oxidative damage in Mammalian cells. Science translational medicine, 5(192), 192ra85. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006055
Kraus, R. L. et al. (2005). Antioxidant properties of minocycline: neuroprotection in an oxidative stress assay and direct radical-scavenging activity. Journal of neurochemistry, 94(3), 819–827. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2005.03219.x
Popovic, N. et al. (2002). Inhibition of autoimmune encephalomyelitis by a tetracycline. Annals of neurology, 51(2), 215–223. https://doi.org/10.1002/ana.10092
Yrjänheikki, J. et al. (1998). Tetracyclines inhibit microglial activation and are neuroprotective in global brain ischemia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(26), 15769–15774. https://doi.org/10.1073/pnas.95.26.15769
Yrjänheikki, J., et al. (1999). A tetracycline derivative, minocycline, reduces inflammation and protects against focal cerebral ischemia with a wide therapeutic window. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(23), 13496–13500. https://doi.org/10.1073/pnas.96.23.13496
*Werbung


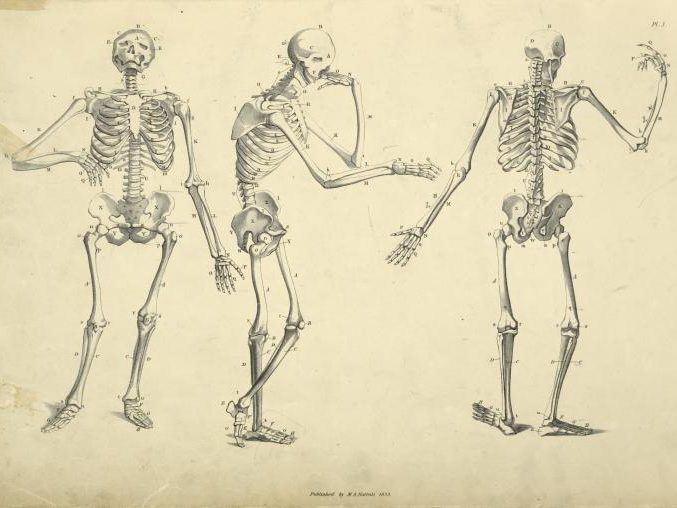
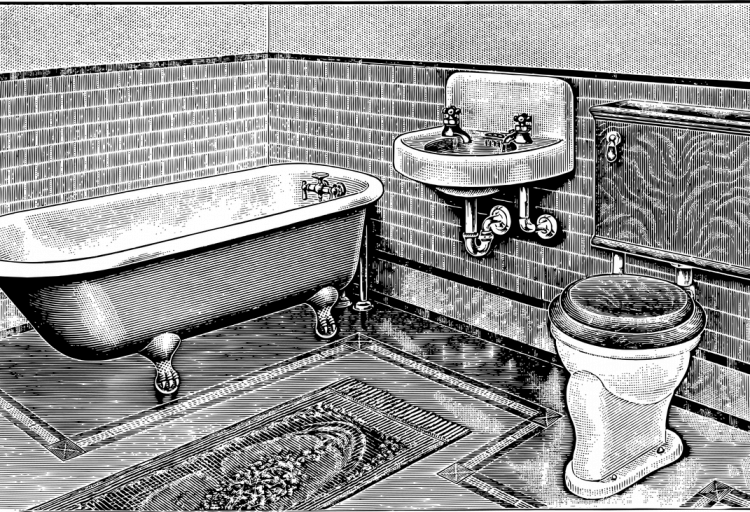
Leave a Reply