Heute habe ich Haut gelassen. Ein kleines Stückchen höchstens, aber dennoch fehlt es (an) mir.
Wahrscheinlich liegt es jetzt irgendwo in einem Laborkühlschrank und wartet frierend darauf, mit Chemikalien beträufelt zu werden. Bestimmt ist es nervös und fühlt sich unbehaglich, weil es in einer trostlosen Petrischale ausharren muss. Ich wünsche meiner Haut von Herzen ganz viel Kraft und danke den betroffenen Zellen für ihr heldenhaftes Opfer.
Klitzekleine Vorgeschichte
Wenn ich vorhabe, unser Dorf zu verlassen, um, sagen wir, auf Menschen zu treffen oder Nahrung zu beschaffen, überlege ich mir vorher ganz genau, was ich anziehe. Nicht wegen der Optik – die würde der hiesigen Tristesse ohnehin nichts anhaben. Ich überlege so genau, weil es hier nicht ist wie anderswo.
Ist der Himmel bei uns grau und riecht die Luft nach Herbst, so wie gestern, weiß ich, dass ich lange Hosen anziehen sollte. Und wenn ich bereits im Flur Gänsehaut bekomme, brauche ich geschlossene Schuhe. Am besten meine allerliebsten Boots, in denen unbemerkt ganze Kiesel steckenbleiben können, bis nach einer Weile jeder Schritt knirscht. Voilà, mein Outfit für den Weg zur Garage ist fertig!
Zwanzig Minuten bei durchschnittlich 80 Kilometer pro Stunde später und einige Höhenmeter tiefer taucht man jedoch abrupt in eine andere Klimazone ein. Denn anders als bei uns scheint in der Stadt im Tal die Sonne. Das Verhältnis zwischen Grabsteinen und lebendigen Einwohnern ist ebenfalls etwas optimistischer. Jedenfalls: Tobt bei uns ein Schneesturm, läuft man dort noch in kurzen Hosen Richtung Freibad. Bei der Wahl der passenden Garderobe sollte man davon wissen!
Doch diesmal war mir das egal. Obwohl mir der eiskalte Wind zugeflüstert hatte, meine Jeans und meine dicken Wollsocken gegen eine kurze Hose einzutauschen, habe ich aus purer Bequemlichkeit darauf verzichtet. Vielleicht aber auch, weil ich befürchtete, nach der kleinen Operation, die mir bevorstand, völlig blutleer nach einer warmen Körperhülle zu lechzen.
Ergo betrat ich die sonnenlichtdurchflutete Praxis des weltnettesten Kieferchirurgen im wulstigen Zwiebellook.
Meine Aufregung ließ anfangs noch auf sich warten. Ich hatte schließlich schon schlimmere Eingriffe überstanden – manche davon sogar ohne Betäubung. Und Schmerzen, egal welcher Art, machen mir ohnehin nichts aus, Grenzüberschreitung nahezu ausgeschlossen. Mir müsste während der Geburt eines über vier Kilo schweren Babys schon die Gebärmutter durchreißen… Ach wartet mal… Déjà-vu?!
Besagtes Baby – mittlerweile sechs Kilo schwerer und sich noch immer keiner Schuld bewusst – kam erst einmal an die Brust! Während ich massakriert werden würde, sollte wenigstens kein Durstgefühl für üble Laune sorgen und meinen Mann, der mich begleitete, zwingen, wider seiner Natur, Gebete in den Himmel zu schicken.
Als unser Sohnemann begann, mich emsig anzuzapfen, staunte ich, wie schnell sich unser zu Milch gewordenes Mittagessen anbahnte.
„Gut so!“, dachte ich, denn zum Stillen blieb nur noch wenig Zeit. Die Milch kam – mein kleiner Abnehmer war in Position – explosionsartig! … mitten in mein Gesicht gespritzt …
Denn unser Wonneproppen hatte sich in letzter Sekunde abgewandt, hin zu einer spektakulären Wandleuchte, deren blendendem Charme er offenbar nicht widerstehen konnte.
„Da!“, rief er ganz aufgeregt, während sich auf meinem Oberteil ein riesiges Milchauge abzeichnete. Grantig zog ich mir den feuchten Stoff über den Kopf und pfropfe ihn in meinen Rucksack. Mein nasses Top versteckte ich unter meiner Sweatjacke.
„Sie können mitkommen!“, rief kurz danach eine helle Stimme. Und so stiefelte ich milchübergossen und in klobigen Boots Richtung OP.
OP-Häubchen und -Füßlinge (die ich kaum über meine riesigen Schuhe gestülpt bekam) komplettierten das abgefahrene Abbild, das ich darstellte und so nahm ich Platz auf einem einsamen Zahnarztstuhl.
„So, wo schneiden wir denn?“, fragte mich eine vermummte Frau und richtete ein Aufgebot verschiedener Messer und Zangen für mich her.
Großäugig folgte ich ihren präzisen Handgriffen und rätselte, ob ich vielleicht fälschlicherweise für etwas Umfangreicheres, wie einen Eingriff am offenen Herzen oder dergleichen, eingetragen worden war.
„Ich weiß nicht. Sollten Sie nicht wissen, wo wir schneiden?“, antwortete ich verunsichert über ihre Frage.
Unter der OP-Haube der Frau wellte sich ihre Stirn und sie trat zu mir heran.
„Hmm“, brummte sie und suchte meinen Arm ab. „Hier ist ein kleiner Fleck. Und da ist noch einer. Welchen sollen wir nehmen?“
Kopfkratzend richtete ich meinen Blick wie ein Mikroskop auf die besagten Flecken.
„Die sind doch niedlich“, stutzte ich. „Von mir aus können die bleiben. Machen Sie lieber nur die Hautbiopsie.“
Auf der Stelle verfiel die Frau in lautes Gelächter, woraufhin eine ebenfalls vermummte Kollegin neugierig durch einen Türspalt zu uns huschte.
„Ach, jetzt ist mir alles klar!“, sagte die Frau, mit der ich gesprochen hatte. „Wenn wir eine Biopsie machen, ist es wirklich wurscht, wo wir schneiden.“
Die gerade dazugekommen Frau warf einen kurzen Blick auf den kleinen Tisch mit den vielen Messern und ging daraufhin zu einem Schrank. Sie öffnete eine Schublade und fischte ein seltsames, helles, zylinderförmiges Ding heraus.
„Wozu brauchen Sie denn einen Ananasschneider?“, erkundigte ich mich und überflog nochmals die lange Besteckreihe, die ich mir nach wie vor nicht zu erklären wusste.
„Das ist der Griff der OP-Lampe“, entgegnete meine Gesprächspartnerin trocken, während die andere Frau selbigen in ein kreisrundes Loch in der Mitte der riesigen Leuchterblume schraubte.
„Oh jaaa!„, war mein letzter Kommentar, bevor ich den Dingen erlaubte, ihren Lauf zu nehmen.
Und dann war es auch schon soweit. Der Chirurg betrat den OP und es konnte losgehen. Detaillierte Beschreibungen erspare ich euch, denn diese wären nicht halb so amüsant wie das, was ihr bereits gelesen habt. Nur soviel: Ich habe in meinen dicken Socken unbeschreiblich stark geschwitzt, das Abschneiden meiner Haut ließ mich kurz in die schlimmsten Szenen eines Splatterfilms eintauchen und obendrein bin ich nun stolze Besitzerin eines neuen Herzens. Oder anders gesagt: eines Lochs im Unterarm.
Ja, und wozu das Ganze?
…wollt ihr wahrscheinlich wissen und sollt auch eine Antwort erhalten: Ich hege den Verdacht, eine genetische Bindegewebserkrankung zu meinen vielen besonderen Eigenheiten zählen zu dürfen. Dass ich besonders beweglich bin, haben schon viele meiner Ärzte erkannt, doch ich möchte wissen, ob ein Zusammenhang mit meiner abgefahrenen Wirbelsäulen-Symptomatik besteht. Meine beiden Tatverdächtigen: das Marfan-Syndrom (dem ich zumindest phänotypisch entspreche) und das Ehlers-Danlos-Syndrom.


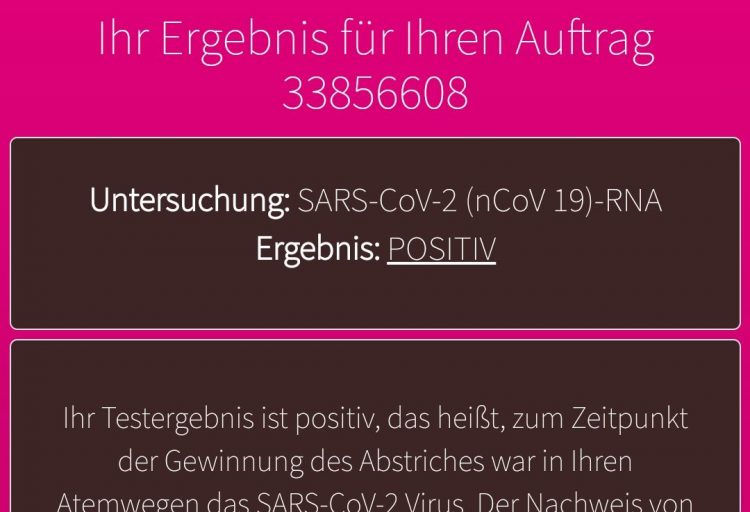

Leave a Reply