Keuchend wie eine herzinsuffiziente Rentnerin schlurfe ich treppauf. In meinem Kopf rumpelt und klackt es, als bestünden meine Halswirbel aus Holzperlen. Oben angekommen öffne ich die Tür zum Büro meines Mannes – nur um für einen Moment bei ihm zu sein, neben ihm zu stehen und mich reumütig auszuweinen. Dann geht es wieder zurück nach unten.
Kleine Anmerkung: Dies ist ein weiterer Eintrag, der drei Jahre später entstand. Es ist eine Retrospektive auf die dunkelste Zeit meines Lebens. Wenn ihr dies lest und gesund seid, dann ermutige ich euch, dankbar zu sein. Wenn es euch jedoch genauso ergeht, wie mir seinerzeit, ermutige ich euch, mit dem Lesen aufzuhören. Ich wüsste jedenfalls nicht, was es euch bringt. Ach so, und ich schreibe diesmal in Präsenz. Damit es so brutal wirkt wie es damals für mich war.
Krankenhaus
Nachdem ich vor meinem mittlerweile völlig verzweifelten Mann in Tränen ausgebrochen bin, fühle ich mich schuldig. Bestimmt ist er jetzt noch verzweifelter. Wenn er könnte, würde er sein Leben zerknüllen, es in den Papierkorb unter seinem Schreibtisch stopfen und ein neues Blatt aus der Schublade ziehen – voller Potential, ohne Knicke und Risse. Und ohne mich.
Doch wohin soll ich mit mir? Mein Körper ist zu einem Folterwerkzeug geworden, das sich gegen sich selbst richtet. Nicht einmal der Stärkste könnte es lange damit aushalten, ohne sich bitterer Verzweiflung hinzugeben, nachdem das ewige Hangeln von Hoffnungsfunke zu Hoffnungsfunke nur noch mehr Frust verursachte. Zu meiner Überraschung scheint Hoffnung dennoch nie ganz auszusterben. In einem Zustand wie meinem existiert sie in abgedroschenen Floskeln, wie etwa: „Es wird alles gut.“ Oder: „Du wirst nicht sterben.“ Doch all das kann mein Mann mir nicht mehr sagen. Er sieht ja, wie schlecht es mir geht.
Zurück auf der Couch versuche ich die letzten Minuten zu genießen und wie unser Sohn schön von einem Stillkissen umhüllt neben mir liegt und schläft. Praktisch wäre es, würde er gar nicht mehr aufwachen und dennoch groß werden und glücklich sein. Ist das nicht vollkommen abstrus?
Und schon kriecht sie wieder hoch – diese Zerrissenheit, diese zerstörerische Gewissheit, sehr bald nicht mehr zu leben, und zugleich die Hoffnung, dass es schnell vorbei sein wird. Diese Symptomachterbahn ist nicht auszuhalten. Kaum liege ich und versuche, mich zu entspannen, schaltet mein Herz schlagartig ab, bis mein Notstromaggregat anspringt und ein Adrenalinstoß mich vor der Ohnmacht bewahrt. Pulsrasen, dann wieder Absacken. Und zwischendurch wird alles taub, zuckt und lässt mich denken, ich sei aus meiner Haut gefahren. Und dann ist es wieder soweit: Alles um mich herum wird dunkel und ich muss kämpfen. Nicht weil ich kämpfen will, sondern weil mein Körper mir das Kämpfen auferlegt. Krankenhaus! Ich muss sofort ins Krankenhaus!
Da gibt es schöne Sachen
Die Notaufnahme ist voll. Da ich bei Bewusstsein bin, habe ich keine Priorität. Unser Sohn ist munter und möchte, dass ich ihn trage. Das mache ich natürlich. Doch dadurch sehe ich vermutlich um ein Vielfaches unbedrohter aus.
Endlich werde ich aufgerufen. Ein Arzt hört sich an, was ich zu sagen habe. Er bemerkt sofort, wie verängstigt ich bin und zieht erste Schlüsse. Blutdruck und Puls sind niedrig, aber in Ordnung. Meine Zunge ist trocken, doch sonst sieht er keinen Grund, mich genauer anzusehen. „Sie haben eine Generalisierte Angststörung„, stellt er nach nicht einmal fünf Minuten fest und schreibt mir eine Überweisung zum Psychiater. „Angst macht solche Symptome“, sagt er teilnahmslos. „Lassen Sie sich ein paar Tabletten geben, da gibt es schöne Sachen.“ Und schon stehe ich im Flur.
Auf der Heimfahrt weine ich. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Bin ich wirklich psychisch krank? Ganz sicher sogar! Ich bin traumatisiert, aber nicht so, wie dieser Arzt es mir weismachen wollte. Mein Mann hält auf einem Parkplatz und umarmt mich. „Wenn kein Arzt etwas findet…“, beginnt er und belässt es schließlich dabei. Ich nehme es ihm nicht übel, denn auch er ist völlig überfordert. Es wäre toll, hätte dieser Arzt Recht. Es wäre toll, bräuchte es nur eine Tablette und alles wäre wieder gut.
Ich sehe unserem Sohn in die Augen und fasse einen Entschluss: Ich werde das durchstehen – irgendwie. Und wenn ich das geschafft habe, werde ich alles tun, um anderen in einer ähnlichen Lage zu helfen.

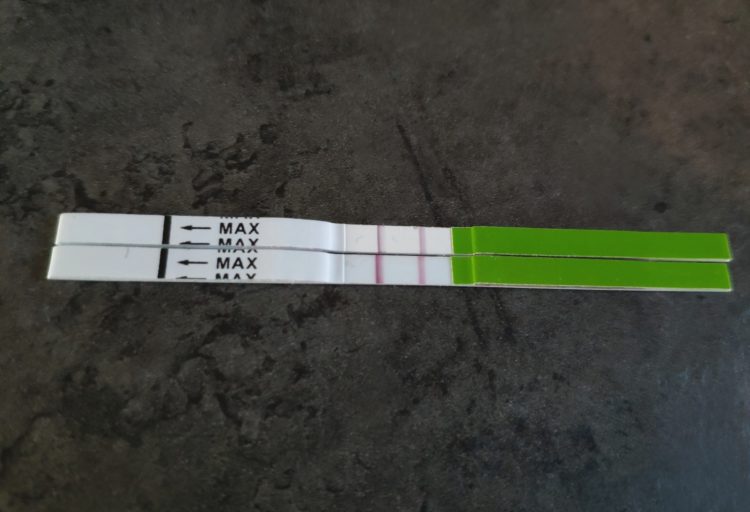


Janina
Puh! Ganz schön heftig und umso schöner, dass es dir heute viel besser geht!
Kannst du dir diese krassen Symptome erklären? Hat das was mit Hirnstamm oder Rückenmark zu tun? Bin noch neu in der CCI-Welt…
christin
Schau mal im Menü unter CCI/AAI und lies dir am besten alle Texte zu den Unterpunkten durch. Aber in Kürze: Instabile Kopfgelenke (verursacht durch Krankheit oder einen Unfall) = Überbeweglichkeit der Kopfgelenke. Das heißt: Wichtige Strukturen, wie das Rückenmark und hirnversorgende Blutgefäße, werden bedrängt und schlimmstenfalls in ihrer Funktion beeinträchtigt. Das Gehirn findet das natürlich doof und schaltet auf Alarm. Der Körper wird daraufhin mit Stickoxiden überflutet und um dies zu kompensieren werden massenhaft wichtige Mikronährstoffe verbraucht. Darunter leiden vor allem die Mitochondrien, unsere Energieerzeuger in den Zellen. Und deshalb gibt’s dann garstige Symptome.
Mehr Details kannst du im Menü finden.
Liebe Grüße!
Christin
Janina
Vielen, vielen Dank fürs Erklären!
Dann forste ich mal hier weiter. Dein Blog ist ein Schatz!
christin
Merci! 😘